Foto: Anna Geisler
Intakte Fließgewässer sind eine wichtige Lebensgrundlage für Pflanzen-, Tierarten und auch den Menschen, doch der Weg zurück zu einem natürlichen Zustand ist keine einfache Aufgabe. Das Europa des 20. Jahrhunderts war geprägt von einer radikalen Umgestaltung und Kultivierung natürlicher Landschaften, was den Verlust natürlicher Ökosysteme zur Folge hatte. Können wir aber die Schäden wieder ungeschehen machen? Restaurationsökologie befasst sich damit, Ökosysteme zu renaturieren. Derartige Bemühungen etablierten sich sukzessive und sind ein bedeutender Bestandteil nicht nur der Restaurationsökologie, sondern auch des gesellschaftlichen Bildes. Gewässer sind eine Lebensgrundlage für Mensch und Natur. Was Gewässerrenaturierung ist, was sie beinhaltet und welche Auswirkungen sie hat – damit befassen wir uns hier am konkreten Beispiel der Liesing.
Jahrzehnte der Veränderung
Gewässer sind ein essenzieller Bestandteil des Lebens und für viele Arten ein wichtiger Lebensraum. Sowohl die Schaffung von Ackerland, als auch die Fragmentierung der natürlichen Umgebung durch Infrastruktur veränderten unsere Ökosysteme teils drastisch. In Österreich führte nicht nur schädliche Einträge intensiver Landwirtschaft, sondern auch drastische Regulierungsmaßnahmen zu einer maßgeblichen Veränderung vieler Fließ- und Stillgewässer und deren Umgebung. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der einst fünf Kilometer breite Auengürtel der ursprünglichen Donau. Altarme wurden vom Hauptstrom getrennt und liefen als Folge Gefahr, zu eutrophieren oder ganz zu versiegen. Für Auen charakteristische Arten verloren ihren Lebensraum.
Begriffserklärung
In der Restaurationsökologie umfasst ähnlich klingende Begrifflichkeiten:
– Restauration sorgt für die Wiederherstellung des Originalzustandes eines Ökosystems.
– Regeneration ist die Reparatur im Hinblick auf einzelne Ökosystemfunktionen.
– Sanierung ist die “Reparatur unter gezieltem Einsatz von Maßnahmen”.
– Renaturierung bedeutet naturnahe Gestaltung, nicht der Originalzustand.
– Revitalisierung kann als Renaturierung oder Sanierung verstanden werden
Quelle: Schaefer, M. (2012). Wörterbuch der Ökologie. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg.
Rückblick auf die Donauregulierung
Während der 1. Donauregulierung in den 1870ern wurde die natürliche Dynamik der Donau gestoppt, ein neues Flussbett für die Donau angelegt und Seitenarme stillgelegt. Die zweite Regulierung erfolgte in den 1970er bis 1980ern, bei der als Hochwasserentlastungsgerinne die Neue Donau angelegt wurde. Seitenarme, wie das Heustadlwasser, wurden zu einem Altwasser, das einer natürlichen Verlandung und Eutrophierung unterworfen ist.
Eutrophierung
Darunter versteht man die Anreicherung von Nährstoffen in einem Ökosystem. Das führt zu einer erhöhten Produktion, d.h. dem Gewinn an Biomasse. Diese wird von Mikroorganismen nach dem Absterben unter Verbrauch von Sauerstoff zersetzt. Der Sauerstoffmangel, der dadurch entstehen kann, wird allgemein als „Umkippen“ eines Gewässers bezeichnet.
Quelle: Schaefer, M. (2012). Wörterbuch der Ökologie. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg.
Die Liesing – Blick in die Vergangenheit
In Rodaun vereinigen sich Dürre und Reiche Liesing zu einem Fluss, dem Liesingbach, der den 23.Bezirk und das Wiener Becken durchfließt. Zwischen 1770 und 1825 kam es zu verstärkten Hochwasserereignissen von Wiener Gewässern, wodurch so auch zunehmend Regulierungsmaßnahmen, also Begradigungen unter anderem der Liesing vorgenommen wurden. Nachdem auch die Siedlungsfläche im 19. Jahrhundert deutlich zunahm, verstärkte auch die steigende Bodenversiegelung die Hochwassergefahr – weitere Regulierungsmaßnahmen waren die Folge. Da auch mehr Abwasser in die Liesing eingeleitet wurden, belastete auch das den Fischbestand.
Besonders intensiv reguliert wurde die Liesing ab 1939: Die Flusssohle wurde abgesenkt, Uferböschungsbefestigungen gebaut und Schottergruben mit Sohlpflasterungen ersetzt. In den 70er Jahren wurde zeitgleich mit Regulierungsmaßnahmen aber bereits mit vereinzelter Renaturierung begonnen. Um 1980 wurden nach vermehrten Hochwasserschäden Rückhaltebecken in Inzersdorf und Alterlaa gebaut. Obwohl die Kanalisation ausgebaut wurde, floss weiterhin verschmutztes Regenwasser in die Liesing.
Auswirkungen der Regulierung
Eine direkte Folge von Regulierungsmaßnahmen eines Flusses nimmt die Fließgeschwindigkeit zu. Oftmals werden auch die Uferbereiche wesentlich steiler und verbaut. Somit ergeben sich teils unmögliche Lebensbedingungen für Arten, die langsam fließende Gewässer und Uferstrukturen benötigen. Da Seitenarme komplett durch Regulierungseingriffe versiegen können, wird nicht nur der Lebensraum eingeschränkt, sondern auch das natürliche Wasserrückhaltepotential. Bei Hochwasserereignissen steigt die Gefahr für den Menschen dadurch sogar noch.

Pläne bis 2027
Bereits über neun Kilometer der Liesing wurden revitalisiert – ein erster Abschnitt bereits 1997, jedoch fand der bisher längste Sanierungsabschnitt zwischen Großmarktstraße und Kledering statt. Die MA45 und Wien Kanal arbeiten in Zusammenarbeit an der Renaturierung der Liesing.
Der Prozess wird in sechs Bauteile eingeteilt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Bauplan vermerkt sind. Finanziert wurde der erste Abschnitt der Liesing durch ein EU-LIFE Projekt. Mit dem LIFE Projekt sollen auch vor allem die Auswirkungen des Klimawandels bearbeitet werden. Die Finanzierung weiterer Bauabschnitte erfolgt durch das Wasserbautenförderungsgesetz bzw. durch den Fördertopf des Umweltförderungsgesetzes. Fertiggestellt werden sollen die verschiedenen Bauteile voraussichtlich 2027.
Maßnahmen der Renaturierung
Wichtige Bestandteile einer Flussrenaturierung beginnen beim Entfernen der Pflasterung, die einst eine Regulierungsmaßnahme war, und können auch Verbreiterungen des Flussufers beinhalten. Sowohl in der Flusssohle, als auch im Uferbereich wurden verschiedene Strukturen eingebracht. Auch die Fließgeschwindigkeit und die Tiefe des Gewässers sollte heterogener werden, da Tiere, wie Fische oder Insekten, unterschiedliche Zonen bevorzugen. Jungfische beispielsweise brauchen Flachwasserbereiche und kleine Buchten mit ruhigem Wasser können essentiell für manche Insektenlarven sein. Barrieren und Verbauungen können Fische schwer oder gar nicht überwinden, weshalb auch hierbei ein Rückbau notwendig wird. Für große Fische sind Kolke oftmals ein geeigneter Lebensraum – das sind Eintiefungen, die in fließenden Gewässern durch Abrieb entstehen.
Nachdem Schritte zur Renaturierung gesetzt werden, soll das Gewässer aber nicht vollkommen sich selbst überlassen sein. Ein regelmäßiges Monitoring und zum Teil auch Pflegemaßnahmen der renaturierten Abschnitte muss geschehen, um den Erfolg der Maßnahmen zu messen und diesen kontinuierlich zu stärken. Zudem zeigt es die Wirksamkeit auf und kann auf zusätzlich nötige Schritte hinweisen.
Strukturreicher Lebensraum für Artenvielfalt
Natürliche bzw. naturnahe Gewässer bieten eine Vielzahl an Strukturen, die von unterschiedlichen Pflanzen- und Tierarten genutzt werden, die wiederum verschiedene ökologische Funktionen haben. Um Beispiele zu nennen – die strukturelle Vielfalt von natürlichen oder naturnahen Gewässern kann durch unterschiedlich große Steine der Gewässersohle entstehen oder tote und lebende Gehölze an Ufern. Diese Elemente im Lebensraum bieten Organismen unterschiedliche Lebensbedingungen. Daher können diese Strukturelemente auch als Maßstab für Biodiversität und Ökosystem Funktion genutzt werden. Denn verschiedene Organismen und Lebensgemeinschaften gedeihen in unterschiedlichen Nischen. An regulierten Flussläufen wird diese Diversität stark eingeschränkt.

Kulturelles Gut und Schutz
Nicht nur den verschiedenen Tier- und Pflanzenarten dienen Renaturierungsmaßnahmen, denn einige wichtige Funktionen dieser Ökosysteme kommen auch Mensch und Gesellschaft zugute. Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen unterstützenden, versorgenden, regulierenden und kulturellen Leistungen. Im Fall von Gewässern betrifft das vor allem kulturelle Leistungen, wie mentale Erholung und Entspannung und auch regulierende Leistungen, die das Wasserrückhaltepotential in Auengebieten. In gewisser Weise dienen natürliche und naturnahe Landschaften sowohl Tieren als auch Menschen auf unterschiedliche Art als Lebensraum.
Strategie zur Renaturierung
Die Wiederherstellung von ökologisch wichtigen Lebensräumen stellt einen Pfeiler der von der Europäischen Kommission formulierten Biodiversitätsstrategie 2030 dar. Inbegriffen in dem 10-Punkte-System ist die “Wiederherstellung für Biodiversität und Klimaschutz besonders wichtiger Ökosysteme”.
Die Renaturierung unterschiedlicher Ökosysteme, wie Wälder, Wiesen, Moore und Gewässer gehört dabei zu einer wesentlichen Aufgabe. Für die Umsetzung sind die jeweiligen Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten bzw. entsprechende Gebietskörperschaften verantwortlich. Aber auch NGOs, Initiativen und Unternehmen setzen sich in Kooperation mit den betroffenen Grundeigentümern für die Umsetzung der qualitativen und quantitativen Ziele ein.
Zurück an den Ursprung?
Die sichtlichen Verbesserungen, die durch die Renaturierung von Lebensräumen erzielt werden, drücken auch die Notwendigkeit dazu aus. Oftmals spielt bei den Erfolgen aber auch der zeitliche Prozess eine Rolle. Morphologische Veränderungen können im Gegensatz zu den biologischen – je nach Zugänglichkeit zum renaturierten Gebiet – schneller beobachtet werden. Die anfängliche Frage danach, ob wir Schäden wieder gut machen können, lässt sich weder mit „ja“ noch „nein“ beantworten. Wir können Fließgewässer Ökosysteme aufgrund heute gegebener Infrastruktur und Besiedelung nicht mehr in ihren ursprünglichen Zustand zurückführen. Aber wir können sie in einen naturnahen Zustand bringen und mit regelmäßiger Pflege die gewünschte Artenvielfalt erhalten.
Weitere Infos zur Liesingbach Renaturierung, findet ihr hier.



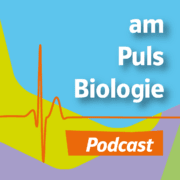

 Sabine Rumpf
Sabine Rumpf 

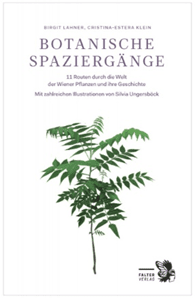



 Arend de Haas – True Nature Foundation
Arend de Haas – True Nature Foundation





 Christian Kantner
Christian Kantner



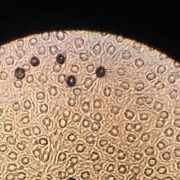 (c) Helena
(c) Helena


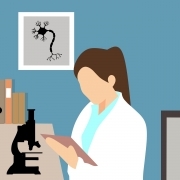
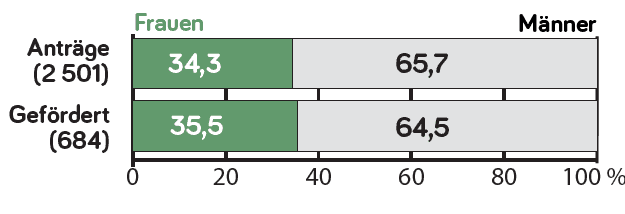
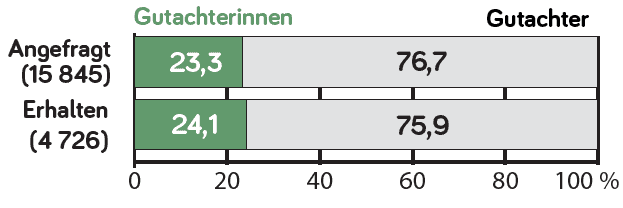
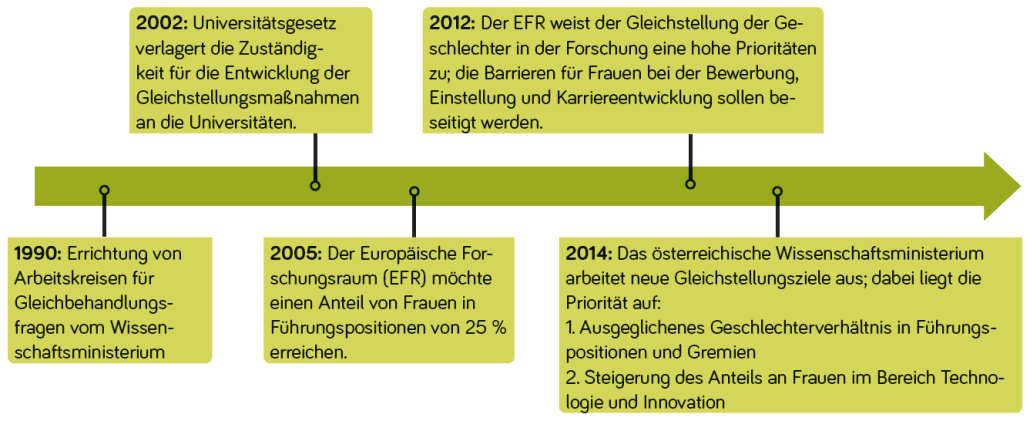
 Yvonne Markl
Yvonne Markl
