Foto: Elisabeth Zeppetzauer, Psitamex
Im Oktober 2023 haben uns Elisabeth Zeppetzauer und Sarai Anaya Valera, Gründerinnen der Organisation Psitamex, bereits von ihrer Arbeit bei einem JOBTalk erzählt. Seitdem ist vieles passiert, das die Ausdauer und Hoffnung auf die Probe stellt und neue große Herausforderungen mit sich bringt. Im Gespräch mit Elisabeth Zeppetzauer erhiet die ABA ein Update über die aktuelle Situation von Psitamex.
Psitamex, eine österreichisch-mexikanische Initiative, steht für „Psitácidos mexicanos“, oder übersetzt „mexikanische Papageien“. Dieser in Mexiko eingetragene Verein wurde von zwei Biologinnen in Mexiko City gegründet: Sarai Anaya Valera and Elisabeth Zeppetzauer. Bereits davor haben sie in einem mexikanischen Auswilderungsprojekt für Papageien mitgearbeitet und dieses koordiniert. Zwei Jahre nach der ersten begleiteten, erfolreichen Auswilderung wurde schließlich der Verein Psitamex gegründet, dessen Ziel es ist, Papageien in Mexiko aus Käfighaltung zu rehabilitieren und in die Freiheit zu entlassen. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist auch die Öffentlichkeitsarbeit, denn viele Papageienarten sind vom Aussterben bedroht.

Artenschutz und Biodiversität – eine enge Vernetzung
Papageien können einerseits als “flagship species”, Flagschiffarten, als auch als “umbrella species”, bzw. Schirmarten, bezeichnet werden. Sie ziehen nicht nur viel Aufmerksamkeit auf sich, sondern sind auch ein wesentlicher Bestandteil des Ökosystems ihrer Heimat. Sie verteilen die Samen verschiedener Pflanzenarten und arbeiten (sozusagen) auch als „Gärtner“ in ihrer Umwelt, da sie Äste von Bäumen stutzen und so zur Lichtverfügbarkeit für Pflanzen beitragen. Das fördert die Diversität und trägt zur Bewaldung bei. Artenschutz und Biodiversität sind somit sehr eng verknüpft.
Als flagship species (Flagschiffart) bezeichnet man eine charismatische, populäre Art, die als Stellvertretung für Naturschutz-Anliegen dienen kann. Umbrella species (Schirmarten) hingegen sind für einen Lebensraum typische Arten, die ebenso zum Erhalt weiterer Arten dieses Lebensraumes beitragen.
Quelle: Wörterbuch der Ökologie
Ein weiterer Bestandteil dieses eng verbundenen Netzwerks ist die Einbindung der lokalen Bevölkerung. Bei Monitoring-Projekten, dem Anbringen von Nistkästen und durch Tourenangebote kann die Selbstwirksamkeit der Bevölkerung gefördert werden.

„Papageien können so auch eine Ressource für die Bevölkerung sein. Die Bevölkerung soll ins Handeln miteingebunden werden, damit auch die Zukunft für die Tiere und Menschen stabiler werden kann. Der Zusammenhang zwischen verschiedenen Feldern rückt immer mehr in den Mittelpunkt: Die Kooperation mit anderen Initiativen, die Kindererziehung oder die Sicherheit der lokalen Bevölkerung spielen alle zusammen.“, betont Elisabeth Zeppetzauer.
Über Elisabeth Zeppetzauer
Elisabeth Zeppetzauer hat in Salzburg Zoologie und Verhaltensforschung studiert und hat sich durch ihre Diplomarbeit näher mit Papageien beschäftigt. Dadurch ist sie in Kontakt mit der ARGE Papageienschutz gekommen, die es in Österreich seit 25 Jahren gibt. Im Jahr 2008 hat Elisabeth die Leitung der Schutzstation der ARGE Papageienschutz übernommen, die sich damals noch in Vösendorf bei Wien befand. In diesem Umfeld hat Elisabeth gelernt, dass ein Papagei durch richtige Haltung, ausreichend Stimulierung und genügend Enrichment wieder zum Wildtier werden kann. Und wenige Monate später war sie bereits in der Koordination eines Auswilderungsprojekts tätig.
Enrichment bzw. Environmental Enrichment soll das Umfeld von Tieren, speziell in Gefangenschaft, stimulierend gestalten, um mehr Abwechslung oder eine naturähnlichere Umgebung zu schaffen. Beispielsweise kann die Futtersuche fordernd gestaltet oder Exploration und Kognition gefördert werden. Einige Möglichkeiten umfassen Spielzeuge, verstecktes Futter oder Pflanzen im Gehege oder der Voliere.
Quelle: Smithsonians National Zoo & Conservation Biology Institute
„Während meiner Tätigkeit bei der ARGE Papageienschutz ist der Gedanke in mir gewachsen, dass ich die Papageien gerne frei lassen möchte.“

Entwicklung der Vision
Seit vielen Jahren lag der Fokus für Psitamex bereits darauf, einen geeigneten eigenen Standort für die eine Auswilderungsstation in Mexiko zu finden. Dabei gab es bestimmte Kriterien zu beachten: gute Erreichbarkeit, die Nähe zu einem Naturschutzgebiet und Gebäude mit einer ökologischen Bauweise. Nach Jahren der Suche wurde der perfekte Standort in Chiapas ausfindig gemacht. Dieser umfasst 500 Hektar und befindet sich nahe der Grenze zu Guatemala in der Pufferzone eines Biosphärenreservats. Am Standort hätten sieben bis zehn wildlebende Papageienarten vorkommen sollen, gesichtet wurde von Psitamex tatsächlich aber nur eine, was das Problem des Artensterbens deutlich widerspiegelt. Der Plan war, dass Psitamex auf diese Weise zu einer schon bestehenden Öko-Gemeinschaft dazustößt. Doch das letzte Jahr offenbarte neue Hürden.
Ein Biosphärenreservat ist ein geschütztes, repräsentatives Ökosystem, dessen genetische Vielfalt vom Menschen unbeeinflusst bleiben soll.
Quelle: Wörterbuch der Ökologie
Herausforderungen in der Umsetzung
Der vergangene Aufenthalt in Mexiko 2024 hat Psitamex vor neue und unerwartete Herausforderungen gestellt, die Elisabeth Zeppetzauer uns folglich darlegt.
1) Waldbrände
Als Folge des Klimawandels werden Waldbrände auch nahe dem Standort für die geplante Auffangstation häufiger. Im April 2024 war das Geländer über fünf Wochen von einem Waldbrand betroffen. Für Elisabeth Zeppetzauer war das die erste Erfahrung mit einem Waldbrand. Da erste Strukturen am Grundstück bereits standen, kehrte Psitamex nach der ersten Flucht in das nächste Dorf anschließend wieder zurück, um die Ausbreitung und Neuentfachung des Brands zu verhindern. Mit Metallrechen und Schaufel legten sie fünf Wochen lang Brandschneisen an und bedeckten Baumstümpfe mit Erde, um die Ausbreitung des Feuers einzubremsen. Durch diesen intensiven Einsatz konnte Schlimmeres verhindert werden.
Aus dieser katastrophalen Situation konnten schließlich aber lehrreiche Schlüsse gezogen werden, die nun auch in die zukünftige Planung einfließen. So soll etwa ein Evakuierungsplan ausgearbeitet werden und auch Wasserauffangmöglichkeiten haben neue Priorität erhalten. Ein weiterer wichtiger Schritt, der zukünftig vor dem Rauch eines Waldbrandes bewahren kann, ist die Wiederherstellung und Aufforstung, da Bäume die Ausbreitung von Rauch einschränken. Diese weiteren Planungspunkte sollen zukünftig berücksichtigt werden. Denn Feuer hinterlässt nicht nur Verwüstung, sondern ist auch ein natürlicher Prozess, der Furchbarkeit und Wachstum fördert.
Die Waldbrände waren jedoch nur eine von mehreren Herausforderungen.
2) Soziale Herausforderungen
Sozial sehr tiefgreifende Probleme haben sich zum selben Zeitpunkt zugespitzt. Die soziale Unsicherheit ist laut Elisabeth Zeppetzauer schon längst sehr hoch. Sie nennt Beispiele, wie Repression durch die Regierung, Waffenschmuggel, Drogenkartelle, organisierter Widerstand der indigenen Bevölkerung und Abwanderung vieler Menschen als Folge. Als Resultat gibt es weniger Struktur, oftmals keine ausreichende, medizinische Hilfe und mangelnde Bildungsmöglichkeiten. Viele der Problemstellen befinden sich direkt vor Ort, da es sehr nahe zur Grenze an Guatemala liegt. Elisabeth erzählt von Migrationsbewegungen, die teilweise von Afrika und Asien über Mittelamerika über die Grenze in die USA gelangen wollen, und die organisierte Kriminalität anziehen können. Diese Situation hat sich vor allem in den vergangenen zwei Jahren zugespitzt, davor waren es friedliche Gemeinden. „Inzwischen ist Gewalt zum Alltag geworden“, beschreibt Elisabeth Zeppetzauer die Situation.
Aktuelle Wahlen hatten diesen Prozess angeheizt, da neue Regierungsposten besetzt werden mussten, was Mord, Entführungen und Korruption mit sich brachte. Elisabeth beschreibt, wie fünf bewaffnete Männer, während Psitamex vor dem Rauch des Waldbrandes flüchten musste, begonnen hatten, Einwohner:innen zu bedrohen und Geldforderungen zu stellen.
Die sozialen Herausforderungen sind eine Hürde für Psitamex und können auch potentielle Folgen, wie illegale Abholzung, mit sich bringen.
Im Moment gibt es nur Gerüchte darüber, was vor Ort geschieht und wann es endet, ist unvorhersehbar. Wann Psitamex den Aufbau der Auffangstation abschließen können ist somit auch nicht klar. Eine Hoffnung ist der bestehende Rechtsanspruch auf das Land, da ein kleiner Teil davon von Psitamex bereits offiziell über einen Notar erworben wurde. Da es ein Biosphärenreservat ist, kann es bei der UNESCO eingeklagt werden.
3) Hitzewelle
Eine weitere Herausforderung, die Elisabeth schildert, war eine von mehreren Hitzewellen im letzten Jahr, die Temperaturen bis über 45°C zur Folge hatte. Sie erzählt von Tieren, die kollabierten und von den Bäumen fielen. Nicht alle Tiere seien dabei sofort gestorben, aber die wenigsten Menschen wussten damit umzugehen. Die Ursache könne zwar nicht bekämpft werden, aber Schadensbegrenzung sei möglich, wenn Menschen informiert werden. Deshalb erstellt Psitamex Infografiken und teilt die Information in sozialen Netzwerken, wie man mit verletzten Tieren umgehen kann. Mit dem Aufstellen von Wassertränken kann zumindest vereinzelt Tieren geholfen werden.
Was bringt die Zukunft?
Der letzte Mexikoaufenthalt zeichnete ein ernüchterndes Bild. Dennoch denkt Elisabeth Zeppetzauer auch an die Zukunft und will versuchen, aus den Umständen lehrreiche Schlüsse zu ziehen. Mit Drohnen sei es etwa möglich, genau zu analysieren, welche Bereiche vom Feuer betroffen sind. Um mit potentiell auftretenden Waldbränden künftig besser umgehen zu können, will Elisabeth Pläne für Wasserrückhaltemöglichkeiten schaffen.
Die Aktivitäten von Psitamex stehen keineswegs still. So wird durch Kooperationen mit anderen Vereinen weiter am Schutz der Papageien gearbeitet. Bis die eigenen Aktivitäten wieder fortgesetzt werden können, hat die Unterstützung durch mediale Aufmerksamkeit, Information der Öffentlichkeit und Spenden anderer Organisationen Priorität. Elisabeth will auch länderübergreifend arbeiten und steuert Kooperationen mit anderen Organisationen an. Ein grundlegender Ansatz, um eine stabile Basis für den Erhalt und Wiedereinführung heimischer Arten zu schaffen ist auch die Wiederherstellung von Ökosystemen.
„Mein Fokus liegt darauf, zurück zum Anfang zu gehen und möglichst viele Papageien freizulassen, weil es für die Vögel und das Ökosystem wichtig ist und in weiterer Folge auch für den Menschen. Es ist emotional befreiend und beglückend, diese Tiere durch den Prozess zu begleiten.“

Vernetzung schafft Hoffnung
Für Psitamex ist es wichtig, den Blick nach vorne nicht zu verlieren. Elisabeth Zeppetzauer will auch dazu ermutigen, die Aufmerksamkeit auch auf positive Veränderungen zu richten und diese auch zu feiern.
Vernetzung mit anderen Initiativen, Vereinen und Einzelpersonen ist für sie von großer Bedeutung. Allen, die sich gerne selbst engagieren wollen, empfiehlt sie ebenfalls, Kontakt zu Personen und Organisationen herzustellen, die sich für Umwelt-, Natur- und Artenschutz einsetzen. Nicht jeder müsse dabei den gleichen Anhaltspunkt haben -für Elisabeth Zeppetzauer sind es die Papageien.

Weitere Informationen
Die Organisation Psitamex finanziert sich unter anderem über Spenden. Wer weitere Informationen über Psitamex oder Unterstützungsmöglichkeiten erhalten möchte, kann sich auf ihrer Webseite informieren oder direkt mit Psitamex in Kontakt treten.Weitere Informationen: https://psitamex.org/
Foto: Psitamex











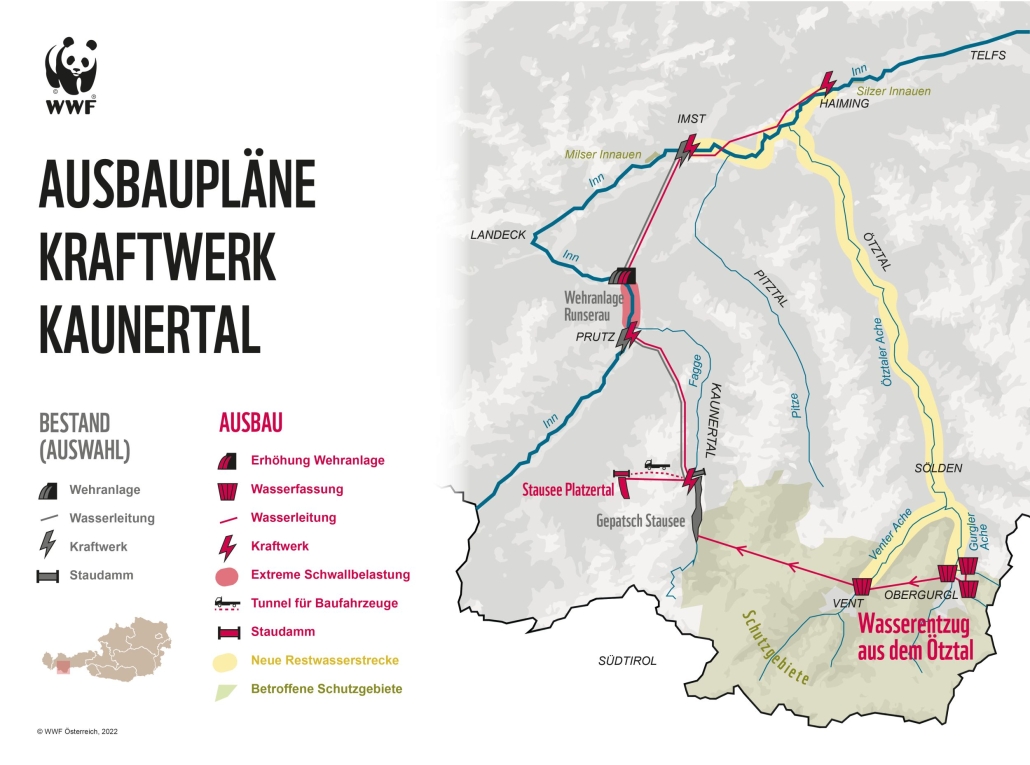
 Arend de Haas – True Nature Foundation
Arend de Haas – True Nature Foundation





 Christian Kantner
Christian Kantner












 ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv
ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv 





 Gregor Subic
Gregor Subic


