Foto: Anna Geisler
Neben der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzung ökologischer Lebensräume, steigt nun auch die Priorität derer Erhaltung und Wiederherstellung. In einem Interview mit Herrn Dr. Thomas Ofenböck befassen wir uns mit der Renaturierung von Fließgewässern in Wien am speziellen Beispiel der Liesing. Herr Dr. Ofenböck der MA45 stellte sich dankenswerter Weise für ein Interview über die bereits erfolgte und weiterhin geplante Renaturierung der Liesing bereit. Das in sechs Abschnitte geteilte Projekt wird zwischen Kaiser-Franz-Josefstraße und Großmarktstraße umgesetzt. Bis 2009 arbeitete Dr. Ofenböck am Institut für Hydrobiologie und ist nun seit September 2009 bei der Stadt Wien angestellt. Dort ist er insbesondere mit der Renaturierung Wiener Fließgewässer involviert.

Wie werden Gewässerabschnitte, wie beispielsweise an der Liesing, für die Renaturierung ausgewählt?
Es gibt die europäische Wasserrahmenrichtlinie, die dazu verpflichtet, alle Gewässer in einen guten Zustand zu bringen. Dazu gibt es auch den nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan, bei dem alle sechs Jahre ein Plan erstellt wird, was in der kommenden Periode an Maßnahmen gesetzt werden. Berichtspflichtig sind Gewässer an über 10 km² Einzugsgebiet, die prinzipiell Priorität haben.
Guter Zustand:
Der gute Zustand eines Gewässers als Vorgabe der Wasserrahmenrichtlinie, setzt sich aus ökologischen, morphologischen, physikalischen und chemischen Komponenten zusammen. Sowohl Lebensgemeinschaften, als auch Aspekte wie Strömung, Flussbettbeschaffenheit und chemische Schadstoffe fallen unter diese Bewertung. Anhand dessen ist eine Bewertung durchzuführen, in wie weit ein Gewässer vom natürlichen Zustand abweicht.
Quelle: Umweltbundesamt
Bei der Prioritätensetzung steht vor allem auch die Durchgängigkeit im Vordergrund. Deshalb werden prioritär auch Gewässerstrecken ausgewählt, die für Lang- und Mittelstreckenwanderer unter den Fischen von Bedeutung sind. Es gab in Wien schon vor der Wasserrahmenrichtlinie eine Prioritätenreihung für mögliche Renaturierungsmaßnahmen.
Aktuell ist die Liesing sehr im Fokus. Dort spielt in die Priorität hinein, dass auch Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich waren. Periodisch wird neu berechnet, ob der Hochwasserschutz noch gewährleistet ist. Wenn sich aufgrund der veränderten Niederschlagsverhältnisse, zunehmenden Starkregenereignisse und des zunehmenden Versiegelungsgrads, ergibt, dass Maßnahmen gesetzt werden sollten, werden solche Gewässer prioritär behandelt. Generell wird versucht Hochwasserschutz und Gewässerrenaturierung zu vereinen.
In Wien sind von den berichtspflichtigen Fließgewässern, die in der Zuständigkeit von Wien als Gemeinde liegen, nur Liesing, Mauerbach und Wienfluss betroffen. Donau und Donaukanal sind in Bundeszuständigkeit, da sie Bundesgewässer und Schifffahrtsstraßen sind. Wir sind zwar als Bundesland verantwortlich, dass Maßnahmen umgesetzt werden, aber die Maßnahmensetzung erfolgt in diesem Fall durch die Via Donau. Das Bundesland ist verantwortlich für die Prioritätensetzung.
Wo macht Gewässer Renaturierung in Wien keinen Sinn?
Prinzipiell ist das Ziel, irgendwann alle Gewässer in einen guten Zustand zu bringen. Dazu gibt es auch zusätzlich das gute ökologische Potential für erheblich veränderte Gewässer.
Gutes ökologisches Potential (GÖP):
Zunächst als Definition des „höchsten ökologischen Potentials“ (HÖP). Dabei handelt es sich um den bestmöglichen Zustand, den ein erheblich verändertes oder artifizielles Gewässer erreichen kann. Als GÖP versteht man eine nur geringe Abweichung des HÖP.
Quelle: Wörterbuch der Ökologie
Die Ausweisung als erheblich verändertes Gewässer erfolgt aufgrund der Hydromorphologie. Wenn es übergeordnete Nutzungen gibt, die den guten Zustand verhindern bzw. wenn man den guten Zustand nicht erreichen könnte, ohne diese übergeordnete Nutzung aufzugeben, hat diese Vorrang. Übergeordnete Nutzungen sind zum Beispiel Hochwasserschutz oder auch Energieerzeugung.
Wienfluss und Liesing sind über das ganze Stadtgebiet als erheblich veränderte Gewässer ausgewiesen. Das heißt, das Ziel ist da nicht der gute Zustand, sondern das gute ökologische Potential. Dieses ist etwas abgemindert, weil es heute im urbanen Raum sehr schwierig ist, Maßnahmen so umzusetzen, dass man wirklich einen guten Zustand erreicht, weil einfach in der Regel der Platz nicht vorhanden ist.
Vom personellen und finanziellen Aufwand ist jetzt die Liesing im Fokus. Dabei ist das Ziel, bis 2027 den gesamten Abschnitt soweit zu renaturieren, wie es im Rahmen der Gegebenheiten möglich ist und so, dass die Durchgängigkeit geschaffen wird.
Wer finanziert das Renaturierungsprojekt an der Liesing?
Der unterste Bereich der Liesing, der schon Anfang der 2000er Jahre renaturiert wurde, war ein LIFE Projekt. Der jetzige Abschnitt wird über das Wasserbautenförderungsgesetz gefördert, weil zu der Zeit keine Mittel aus dem Umweltförderungsgesetz zur Verfügung standen und weil es auch eine Hochwasserschutzmaßnahme ist. Für rein morphologischen Maßnahmen gibt’s einen eigenen Fördertopf über das Umweltförderungsgesetz. Dieser ist wurde mit 200 Millionen Euro dotiert. Und da ist die Bundesförderung 60% für kommunale Teilnehmer.
Was ist nach der Auswahl des Gewässerabschnitts der erste Schritt der Renaturierung?
Im Rahmen des nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans werden Grundlagen ja schon erhoben und es gibt auch eine Risikoanalyse. Dazu gibt es natürlich auch Monitoring. Die Biologie steht dabei im Vordergrund. Da werden die Abschnitte festgelegt, an denen Maßnahmen gesetzt werden sollen und auch festgelegt, welche das sind. Das sind morphologische Maßnahmen oder stoffliche, je nachdem, was das biologische Monitoring aussagt. Für das gute ökologische Potential muss man auf jeden Fall einen guten stofflichen Zustand erreichen.
Was sind stoffliche Belastungen?
An der Liesing haben wir eine stoffliche Belastung, allerdings auch schon aus Niederösterreich. Es kommt natürlich im Stadtgebiet noch einiges hinzu. Wir haben an der Liesing beim Kanalsystem ein Trennsystem, das für Wien einzigartig ist. Das Schmutzwasser wird zur Kläranlage geleitet, aber das Regenwasser geht direkt in die Liesing. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, dass mit dem Regenwasser einiges an Einträgen mitkommt. Im Regenwasserfall gibt es dabei eine relativ große Verdünnung, das wirkt sich nicht so stark aus. Was wir festgestellt haben ist, dass es im Trockenwetterfall immer wieder zu Fehleinleitungen kommt. Was vielleicht im guten Glauben, dass der Kanal in die Kläranlage führe, in den Kanal geleert wird, gelangt in Wirklichkeit in die Liesing. Zum Teil werden auch ohne Bewilligung Bauwässer eingeleitet, aber es hat auch immer wieder größere Unfälle gegeben.
Die ganzen Wienerwaldbäche kommen aus dem Flysch-Einzugsgebiet. Diese haben bei Niederwasser sehr niedrigen Abfluss, bei Hochwasser dafür sehr schnell einen hohen Abfluss. Deshalb gibt es natürlich keine Verdünnung und ein Eintrag wirkt sich schon sehr stark aus und es kann zu Fischsterben kommen. Die größeren Ereignisse fallen natürlich eher auf, aber man kann davon ausgehen, dass immer eine kleine Belastung stattfindet. Auf den Straßen kommt es natürlich auch zu Staub- und Reifenabrieb und wenn es regnet, hat gelangen diese Verunreinigungen in den ersten Spülstoß.
Flysch:
Ein Schweizer Ausdruck. Eine regelmäßige Schichtung von hauptsächlich Sandsteinen und Mergeln. Der Aufbau ist sehr instabil und neigt zu Hangrutschungen. In Österreich reicht diese Zone vom Nordrand der Ostalpen bis Wien.
Quelle: https://www.gamssteig.de/lexikon/flysch
Welche Maßnahmen gegen solche stofflichen Belastungen gibt es?
Die Lösung dafür ist nicht, die ganzen Regenwässer in die Kläranlage ableiten – das ist seitens der Dimension schwierig – sondern, dass man Begleitkanäle baut, die kleinere Einträge im Trockenwetterfall abfangen können und in die Kläranlage leiten. Wenn es stark regnet, kann so der erste Spülstoß noch aufgefangen werden. Dabei gibt es einen Überlauf, bei dem das Regenwasser bei länger andauerndem Regen wieder in die Liesing führt. Prinzipiell ist es ja erwünscht, das Wasser wieder dem Fließgewässer zukommen zu lassen, weil wir ohnehin oft sehr niedrige Wasserstände haben, was sich durch den Klimawandel verschärft.
Das größere Problem sind die diffusen Belastungen, die über das Einzugsgebiet kommen. Im ländlichen Gebiet stammen diese von Ackerflächen, bei denen Nährstoffe in das Feld eingetragen werden, die dann wieder in die Gewässer gelangen. In intensiv genutzten Gebieten passiert das sehr häufig. Man kann als Maßnahme entweder Programme zur Reduktion der Düngung durchführen, was anschließend vom Land verordnet werden kann oder Pufferstreifen entlang von Gewässern anlegen, in denen man eine gewisse Vegetationszone zur Verfügung hat, durch die diese Nährstoffe zurückgehalten werden. Das Problem ist oft, dass bis zum Gewässerrand geackert wird.
Die Kläranlage in Breitenfurt ist zwar am neuesten Stand, aber von der Kapazität bei Starkregenereignissen dann auch nicht ganz ausreichend.
Kann es von der Bevölkerung bei solchen Projekten zu Widerständen kommen?
Das hatten wir in Wien selbst noch nie. Es ist in der Regel so, dass Renaturierungsmaßnahmen sehr befürwortet werden und dass die Rückmeldungen im Nachhinein sehr positiv sind. Während die Baustelle aktiv ist, hat man in der Regel eine gewisse Lärmbelästigung. Wir versuchen, das Material – die Pflasterung, die abgebaut wird, gleich vor Ort wiedereinzubauen. Es gibt Anlagen, die die Steine brechen und das bringt natürlich eine gewisse Lärmbelästigung. Wenn ein Baum gefällt werden musste, damit man etwas Platz schafft, gab es schon Proteste. Aber insgesamt gibt es keinen Widerstand gegen die Renaturierung und im Nachhinein waren die Reaktionen wirklich immer positiv.
Gibt es vor dem Setzen der Maßnahmen Informationen für die Bevölkerung?
Bei größeren Eingriffen, ja. Wir haben ja ein eigenes Infocenter an der Liesing. Es wird über den Bezirk natürlich kommuniziert. Vor Beginn hat es bereits die Möglichkeit gegeben, sich darüber zu informieren.
Wenn ein Abschnitt renaturiert wurde, welche Maßnahmen muss man weiterhin setzen?
Es braucht immer ein Pflegekonzept dazu, das in der Regel auch im Wasserrechtsverfahren vorgeschrieben wird. Dabei geht es vor allem darum, den Hochwasserschutz zu gewährleisten. Das Ziel ist zumindest, ein 100-jährliches Hochwasser, schadlos abzuführen. Wenn man begrünt und Bäume setzt, muss man darauf achten, dass man den Hochwasserabfluss nicht gefährdet. Die Bäume dürfen nicht zu groß werden. In den Pflegekonzepten wird abschnittsweise festgelegt, welche Bereiche kritisch sind – dort kann man sehr wenig Bepflanzung zulassen.
Ein großes Thema aktuell ist der Klimawandel. Böschungen sind sehr trockene Standorte. Das sollte in der Pflege schon entsprechend berücksichtigt werden. Wenn man die Bepflanzung durchführt, versuchen wir in letzter Zeit mehr Wildaufgeher zu fördern, weil die wesentlich widerstandsfähiger sind und sich besser entwickeln als Bäume in der Baumschule.
Die Böschungen müssen von Zeit zu Zeit auch gemäht werden. Wir versuchen, natürliche Wiesenbestände aufkommen zu lassen und keine Rasenpflege zu betreiben, um auch Blühpflanzen zu fördern.
Gibt es mit Neophyten Probleme bzw. kann man gegen diese vorgehen?
Fallopia japonica, der Japanische Staudenknöterich:
Eine schnellwüchsige, widerstandsfähige Pflanze, die in Japan, China und Korea beheimatet ist. Sie wurde als Futter- und Zierpflanze auch bei uns eingebracht und setzt sich leicht gegen einheimische Arten durch.
Quelle: Landwirtschaftskammer
Weniger bei der Liesing, aber mehr am Wienfluss haben wir große Probleme, gerade mit Fallopia. In den Wienflussbetten hat sich das sehr stark ausgebreitet und es gibt leider überhaupt kein Mittel dagegen, wie man die wirklich bekämpfen kann. Wenn es ganz kleinräumig ist und man sofort Maßnahmen ergreift, hat man eine Chance. Man muss die Pflanzen auch fachgerecht entsorgen. Man kann sie kompostieren in der Kompostieranlage in Wien. Angeblich sind die Temperaturen dort so hoch, dass sie nicht überleben können. Ansonsten muss man sie entweder komplett austrocknen lassen oder verbrennen. Wenn man die Pflanzenreste in den Wiener Restmüll gibt, werden sie mit Sicherheit verbrannt. Das Problem ist, dass Fallopia sehr tief wurzelt und sehr regenerationsstark ist. Es gibt sogar Berichte, bei denen sie bis fünf Meter wurzeln konnten. Man muss aber mindestens ein bis zwei Meter das Erdreich ausheben.
Ein weiteres Problem ist, dass sie echte Monokulturen schaffen und jeder Trieb, der abbricht, sofort wieder austreiben kann. Wenn bei Hochwasser an verschiedenen Stellen die Triebe anlanden, die durch das Hochwasser abgerissen wurden, fangen viele davon sofort an, auszutreiben und man hat wieder einen neuen Bestand.
Wir haben aktuell Versuche auf der Donauinsel laufen, bei denen man den Oberboden abgetragen hat, Unkrautvlies und wieder mit Erde bedeckt hat und diese Stellen anschließend mit Weiden bepflanzt. So wird das Wachstum möglichst unterdrückt. Sie kommen mit der Zeit zwar doch wieder durch, aber das Ziel ist, so viel Beschattung zu schaffen, dass sich der Staudenknöterich nicht durchsetzen kann. In Gewässernähe funktioniert es mit Weiden sehr gut, weil diese sehr schnellwüchsig und regenerationsfähig sind.
Das Ganze ist allerdings sehr aufwendig und deshalb auch nicht unbedingt die großflächige Lösung. Man kann Fallopia auch sehr intensiv mähen über viele Jahre. Aber an den Stellen, wo das gemacht wird, gibt es sogar einige, die nach 10 Jahren wieder zurückkommen. In gewissen Bereichen bekämpfen wir Fallopia regelmäßig. Auch beim Riesenbärenklau – wenn der auftaucht, wird sofort etwas gemacht. Bei Fallopia nur dort, wo einzelne, kleine Bestände sind und man eine realistische Chance hat.
Gibt es regelmäßiges Monitoring durch die Stadt Wien?
In Wien haben wir regelmäßiges Landesmonitoring, bei dem natürliche Qualitätselemente untersucht werden. Im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie sind das die Fische, das Makrozoobenthos und das Phytobenthos. Da gibt es ein Monitoring Programm, bei dem je nach Bedeutung und Größe des Gewässers, unterschiedlich häufig Untersuchungen durchgeführt werden. Das ist vor allem auch wichtig, um den Erfolg von solchen Maßnahmen zu belegen. Und einer der großen Vorteile in der Stadt ist, dass die Ausgangssituation in der Regel so schlecht ist, dass man immer einen Erfolg nachweisen kann. Bei anderen Flüssen ist das oft sehr schwierig: Es werden teure Maßnahmen umgesetzt, zum Beispiel eine große Aufweitung auf mehreren 100 Metern, und oft kann man nicht nachweisen, wenn man den ökologischen Zustand ermittelt, dass es wirklich Verbesserungen gibt, weil diese graduell stattfinden. Oft können Arten gar nicht zuwandern, weil sie durch Hürden gar nicht dorthin gelangen.
Phytobenthos und Makrozoobenthos:
Das Benthos beinhaltet alle bodenbewohnenden Organismen eines Gewässers. Daher bezieht sich das Makrozoobenthos auf alle wirbellosen Tiere der Gewässersohle mit über 1mm. Das Phytobenthos sind dementsprechend die Pflanzen, die den Gewässerboden bewachsen.
Quelle: Amt der oÖ Landesregierung
Bei der Renaturierung der Liesing im untersten Bereich, schon vor 20 Jahren, fand im Rahmen des LIFE Projekts ein intensives Monitoring statt. Dabei sind auch die Libellen, Uferkäfer und Makrozoobenthos betrachtet worden und man konnte zeigen, wie schnell der Bach wieder besiedelt wird. Dort hat sich aber die Problematik der Nährstoffeinträge gezeigt und zusätzlich die Schadstoffeinträge aus dem Regenwasserkanal. Wir haben danach auch noch längere Zeit Monitoring durchgeführt und konnten so feststellen, dass die Artenzahlen steigen. Wenn ein derartiger Schadstoffeintrag stattfand, wurde die Zönose wieder fünf Jahre zurückgeworfen. Sensible Arten fallen dann wieder aus und es dauert eine gewisse Zeit, bis sie sich wieder etablieren können. Das war der Grund, aus dem man wusste, dass man diese Einträge über das Regenwasser möglichst reduzieren muss.
Im Rahmen des Landesmonitorings haben wir in größeren Abständen auch chemisch-physikalische Untersuchungen. Dazu gibt es heuer wieder aktuell ein laufendes Programm, bei dem die wichtigsten Fließgewässer untersucht werden. Dabei gibt es monatliche Beprobungen über ein Jahr, woraufhin man z.B. vergleichen kann, wie sich die Parameter in den letzten 10 Jahren verändert haben. Maßgebend für die Bewertung des ökologischen Zustands sind aber die biologischen Parameter.
Warum ist Gewässer Renaturierung wichtig?
Eine sehr philosophische Frage. Weil man wieder ein bisschen gut machen kann, was in der Vergangenheit passiert ist – auch aus gutem Grund, das darf man auch nicht vergessen. Der Wienfluss ist nicht aus Spaß so verbaut worden. Das war ein sehr verzweigtes Gewässersystem, aber im Zuge der industriellen Revolution haben sich immer mehr Betriebe angesiedelt und es sind Abwässer direkt in das Gewässer geleitet worden. In dieser Zeit war das auch ein Abwasserkanal, der bei Hochwässern über die Ufer getreten ist. So sind die Giftstoffe und Keime auch in das Grundwasser gelangt und es gab immer wieder große Choleraepidemien. Deshalb hat man es damals auch so massiv verbaut. Das ist auch der Grund, warum so viele Bäche, die aus dem Wienerwald kommen, verrohrt wurden. Es war auch eine große Geruchsbelästigung und ein hygienisches Problem.
Heute wären wir froh, wenn wir diese Bäche im natürlichen Zustand wieder hätten. Jetzt ist es leider in der Regel zu spät.
Es ist unsere Verpflichtung, den nachfolgenden Generationen gegenüber, wieder etwas gut zu machen. Es ist auch für die Stadt besonders wichtig im Zuge des Klimawandels, weil solche Grünachsen wichtig sind für das Stadtklima. Es sind oft Frischluftschneisen und Wanderkorridore, nicht nur für aquatische Arten, sondern auch zur Orientierung für Vögel und terrestrische Insekten. Was in der Stadt auch eine besondere Rolle spielt, ist die Verbesserung der Naherholung. Dies ist auch wichtig dafür, damit man die Finanzierung politisch argumentieren kann, dass man Millionen investiert, weil so auch die Bevölkerung davon profitiert.
Den Menschen zieht es immer zum Wasser. Wohnen am Wasser erhöht die Lebensqualität sehr stark und es hat aus meiner Sicht einen Klimaschutzeffekt auch dahingehend, dass man nicht unbedingt darauf angewiesen ist, weit weg zu fahren, sondern man kann sich auch vor der Haustüre erholen. Wien hat dabei den Vorteil mit dem Donauraum. Hier hat man Naherholungsgebiete direkt vor der Haustüre.
Ich bedanke mich im Namen von bioskop für das informative Interview!
Weiterführende Links:
bioskop Beitrag:
Österreichs Fließgewässer: geprägt durch Regulierung und Renaturierung



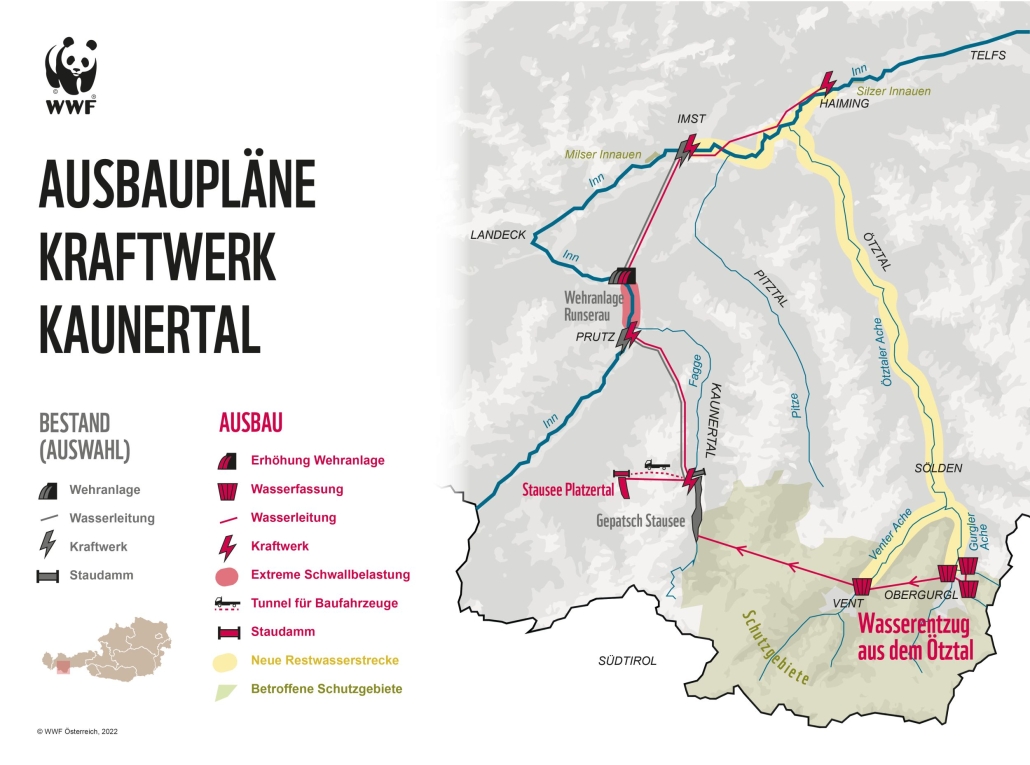
 Arend de Haas – True Nature Foundation
Arend de Haas – True Nature Foundation










 Mittermueller
Mittermueller 





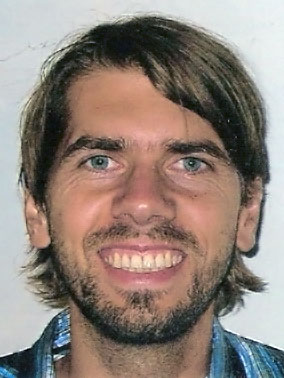





 Isabella Busch
Isabella Busch
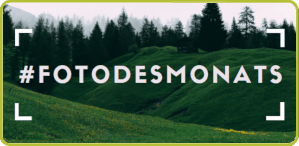


 Andreas Pospisil
Andreas Pospisil


