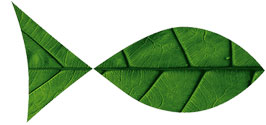Marc ist seit knapp vier Jahren als selbstständiger Reportage/Naturfotograf tätig. Er verbindet mit seinen Foto-Reportagen und Multimedia-Produkten Biologie und Fotografie und setzt auf die Medien Bild und Text als Botschafter in Sachen Naturschutz. Seine Arbeiten werden regelmäßig in österreichischen Magazinen, wie dem Universum Magazin und Illustrierten veröffentlicht. Für den Nationalpark Thayatal hat er in den letzten zwei Jahren an einer Multimedia-Kampagne gearbeitet und gemeinsam mit seiner Partnerin, der Ökologin und Autorin Christine Sonvilla, zeigt er sein Erlebtes auch in Vorträgen.
1) Marc, beschreibe bitte kurz Deinen Arbeitsalltag. Was sind Deine Hauptaufgaben?
Einen typischen, geregelten Arbeitsalltag gibt es in dem Sinn nicht. Es geht vielmehr darum, kreativ zu sein und die eigenen Ideen konsequent zu verfolgen. Den Workflow würde ich so beschreiben:
Ideenfindung – Umsetzung (Fotografieren, Filmen) – Aufbereitung – Präsentation.
2) Was gefällt Dir an Deinem Job am meisten?
Es ist schön, ein Produkt vom Anfang bis zum Ende komplett selbst schaffen zu können. Flexibilität und Kreativität bekommen dabei auch einen neuen Stellenwert. Ich weiß nicht, ob ich da für andere sprechen kann, aber mich beflügelt ein neues Projekt jedesmal aufs Neue. Das gibt Kraft und macht Spaß, ist gleichzeitig aber natürlich auch Arbeit, die ich dafür aber gerne „in Kauf nehme“.
3) Was gehört zu den schwierigsten Dingen in Deinem Beruf? Was sind für Dich die größten Herausforderungen?
Auf sich aufmerksam zu machen, gehört sicher zu den schwierigen Schritten in die Selbstständigkeit. Der beste Antrieb dafür ist aber sicher auch der eigene Ehrgeiz. Je mehr ich mich selbst antreibe, desto mehr kann ich erreichen. Das ist das Schöne an der Selbstständigkeit. Der Rest ist dann eine Frage der Konsequenz.
4) Wie bist Du auf diesen Job aufmerksam geworden?
Die Idee, selbstständig an Natur- und Tierthemen als Fotograf/Filmer zu arbeiten, gehört schon seit Ewigkeiten einfach dazu. Das Studium hat mich darin aber sicher noch bestärkt. Vielen Forschungsthemen fehlt, meiner Meinung nach, oftmals ein öffentliches Sprachrohr außerhalb der Wissenschaften. Und in dieser Tätigkeit verstehe ich Fotografie als sehr effizientes und universelles Werkzeug.
5) Welche Qualifikationen waren besonders entscheidend, dass Du diesen Job bekommen hast?
Der Studienabschluss war für mich genauso wichtig, wie die fachliche Kompetenz in der Fotografie. Gerade in diesem Job gibt es aber keinen finalen Status Quo. Oftmals braucht es zur Umsetzung neuer Ideen auch neue Hilfsmittel, neue Techniken, etc. Es ist also ein ständiger Lern- oder besser Entwicklungsprozess. Das macht das Ganze aber auch spannend und abwechslungsreich.
6) War es schon immer Dein Wunsch eine Arbeit dieser Art auszuüben oder hattest Du früher andere Berufswünsche?
Kurz und bündig – schon immer.
7) Wie siehst Du die Arbeitsmarktsituation in Deinem Umfeld? Gibt es für BiologInnen Arbeitsmöglichkeiten?
Ich denke, dass die Biologie enormes Potenzial hat, mit anderen Fachdisziplinen, wie Wirtschaft, Recht, Kommunikation, etc. kombiniert zu werden. Natur und Umwelt haben auf uns und all unsere Lebensaspekte enormen Einfluss und auch auf unser Wirtschaften. Das im Studium erworbene KnowHow ist dabei extrem wertvoll. Vor allem das Wissen und das Verständnis für den Wert einer funktionierenden Lebewelt kann/muss/soll/ darf der Öffentlichkeit mitgeteilt werden und wer könnte das besser, als BiologInnen? Mit einer gesunden Portion Kreativität finden sich so für geeignete BiologInnen in vielen Bereichen Arbeitsmöglichkeiten.
8) Ist ein Biologiestudium für Deine Position notwendig, welche anderen Ausbildungen wären hilfreich?
Gerade im Bereich Natur/Tierfotografie ist fundiertes Wissen über Flora und Fauna und die Zusammenhänge in unserer Umwelt nicht nur hilfreich, sondern wichtig für alle Beteiligten. Fotograf und Umwelt. Es hilft nicht nur in der Umsetzung eigener Ideen und Projekte. Es lassen sich so auch Konflikte beim Arbeiten vermeiden. Die Arbeit eines Naturfotografen soll ja im Sinne der Natur stehen und dabei keinen negativen Einfluss auf sie nehmen. Es geht nicht um das Foto um jeden Preis, sondern darum, den richtigen Moment einzufangen. Dabei gehört es auch dazu, sich zurücknehmen zu können und Tieren, Pflanzen, der Natur generell ihren Raum zu lassen. Dieses Wissen und dieser Respekt der Umwelt gegenüber, werden einem im Studium sicher nahegelegt.
9) Welche Inhalte des Biologiestudiums benötigst Du in Deinem Berufsalltag am häufigsten?
Vor allem Naturschutzrecht und Artenschutz. Mit diesen Themen setze ich mich thematisch am häufigsten auseinander.
10) Was würdest Du Biologiestudierenden raten, die sich für einen ähnlichen Job interessieren?
Die eigenen Ziele mit Konsequenz und Spaß zu verfolgen. Je ausgereifter und klarer die eigene Vorstellung von Beruf und der eigenen Zukunft ist, desto einfacher ist es auch sie umzusetzen. Wie mit meiner fotografischen Arbeit, so sehe ich es auch mit der beruflichen Orientierung: je klarer die Idee am Anfang, desto schneller die Umsetzung. Ob ich nun Fotograf, Grundlagenforscher oder Biologe im Feld sein möchte – je klarer ich meine Ziele sehe, desto schneller werden sie Realität.
Vielen Dank für das Interview!
Marc Graf
GRAF MARC Photography

 Marc Graf
Marc Graf lukas landler
lukas landler
 Clemens Gumpinger
Clemens Gumpinger