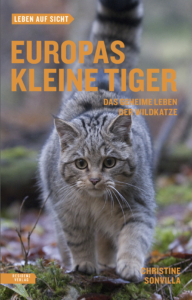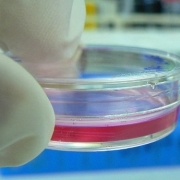Foto: https://meeresschule-pula.com/#top
Unseren ersten JOBTalk im Wintersemester 2024 hat Mag. Gerwin Gretschel aus Graz eingeleitet. Im online Gespräch zeigte Gerwin den rund 20 Teilnehmer:innen seine Leidenschaft für Meeresbiologie und Naturpädagogik. Anschließend gab es wie immer die Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu treten, was zu einem besonders interaktivem Zusammentreffen junger Biolog:innen und interessierten Menschen führte.
In den JOBTalks der Austrian Biologist Association geht es darum, vor allem Studierenden und jungen Biolog:innen zukünftige Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen und Vernetzung zu ermöglichen. Dabei lernen sie Biolog:innen in verschiedenen Berufen und mit unterschiedlichsten Schwerpunkten während eines Interviews kennen und können auch selbst Fragen stellen.
Mag. Gerwin Gretschel gründete 2000 die Meeresschule in Pula, die sich besonders an Schulklassen wendet. Damit soll die Begeisterung für die Natur an andere geweckt und das Bewusstsein für die Umwelt, mit dem Meer als Schwerpunkt, langfristig gestärkt werden. Gerwin, der selbst seit seiner Kindheit diese Begeisterung in sich trägt, vermittelt mittels Naturpädagogik den ökologischen Wert dieser Ökosysteme.
Da er die Degradierung der Lebensräume selbst beobachten konnte, möchte er vor der Öffentlichkeit nicht schweigen. Er spricht in diesem Sinne auch die wissenschaftliche Arbeit an, deren Potential in diesem Bereich noch weitaus nicht ausgeschöpft ist.
Der Weg zum leidenschaftlichen Meeresbiologen war auch für Gerwin nicht linear, wie er uns im Dialog erklärt. In seinem Fall war es notwendig, sich einen eigenen Job zu gestalten. Der zeitliche Aufwand und auch der finanzieller Selbsterhalt stellen oft auch Hindernisse und Herausforderungen in den Weg. Sehr ausdrücklich ging Gerwin auch darauf ein, wie wichtig es ist, den Bereich zu finden, für den man Begeisterung aufbringen kann. Diese ist auch wichtig, um Hindernisse und Rückschläge zu überwinden.
Publikumsdialog:
Was hat dir geholfen, um eine Entscheidung für eine wissenschaftliche Karriere oder für eine biologische Karriere ohne Ph.D. zu treffen?
Gerwin: Das weiß man oft erst im Nachhinein. Für mich habe ich die passende Karriere ohne Ph.D. gefunden, da ich so die Nähe zur Natur viel mehr ausleben kann. Ich bereue es nicht!
Haben wir als Biologen den Bildungsauftrag an die Bevölkerung, um auf die Lebensraum Degradierung hinzuweisen?
Gerwin: Ja, wir haben die Ausbildung und das Wissen. Deshalb gehört es auch zu unseren Aufgaben, dieses zu vermitteln und die Begeisterung für Natur und Umwelt zu teilen. Jeder Schritt zur Verbesserung ist wichtig und wir spielen als Biolog:innen dabei eine wichtige Rolle.
Welche Möglichkeiten gibt es für Praktika bei Ihnen?
Gerwin: Wir bieten immer wieder Praktika an für junge, engagierte Leute, die selbst nach Erfahrung im Bereich Meeresbiologie suchen. Dabei können wir eine gratis Unterkunft anbieten und die Möglichkeit auf einen Tauchkurs. Bei Interesse ist es am besten, direkt den Kontakt aufzunehmen. Die Informationen dazu gibt es auch der Homepage der Meeresschule.

Mit der Herausforderung, den passenden, beruflichen Weg zu wählen und die Begeisterung dafür zu behalten, können sich sicherlich viele identifizieren. Umso inspirierender ist die Tatsache, dass es mit Ausdauer und gelegentlichen Fehlschlägen möglich ist, die eigenen Ziele zu erreichen. Die Zeit, die es dafür braucht, unterscheidet sich dabei möglicher Weise individuell, aber die gewonnenen Erfahrungen sind umso wertvoller.
Wir freuen uns über das spannende Gespräch und die besonders interaktive Teilnahme am aktuellen Jobtalk. Im Namen der Austrian Biologist Association bedanken wir uns bei Mag. Gerwin Gretschel für seinen inspirierenden und zuversichtlichen Zugang zur Natur und Meeresbiologie!
Informationen über Praktika findest Du hier:
https://meeresschule-pula.com/aktivitaeten/praktikum-an-der-meeresschule/