Dass Froschmännchen durch lautes und ausdauerndes Quaken auf sich aufmerksam machen wird auch in Österreich in den Sommermonaten eindrucksvoll demonstriert. Afrikanische Riedfrösche gehen möglichweise noch einen großen Schritt weiter und machen sich nicht nur durch Rufe, sondern auch durch Duftstoffe und visuelle Signale bei Artgenossen bemerkbar.
Riedfrösche (Hyperoliidae) sind eine in Afrika weit verbreitete Froschfamilie mit einer großen Vielfalt an Körperformen, Hautmustern und Fortpflanzungsstrategien. Jedoch haben alle der über 200 Arten neben der Nachtaktivität und dem häufigen Vorkommen in offenen Sumpfgebieten (Bild 1) eine wichtige Gemeinsamkeit: Männchen haben einen auffälligen Fleck auf der Schallblase (siehe Hyperolius lateralis im Titelbild dieses Beitrags). Dieses außergewöhnliche Merkmal wird in der Bestimmungsliteratur schon seit Jahrzehnten verwendet, aber die Funktion des Schallblasenflecks ist bis heute unklar.

Da sich die Schallblase beim Rufen unweigerlich bewegt, liegt die Vermutung nahe, dass der meist färbige Kehlfleck ein visuelles Signal ist, das den anwandernden Weibchen die Nahortung des rufenden Männchens im Schilfdickicht erleichtert.

Auffällig ist aber auch die Blutversorgung des Kehlflecks (Bild 2), die darauf schließen lässt, dass es sich nicht nur um anders gefärbte Schallblasenhaut, sondern um Drüsengewebe handeln könnte.
In unserer Studie haben wir zuerst histologische Schnitte von Riedfroschmännchen angefertigt und konnten so die Zellzusammensetzung der Schallblase und des Kehlflecks vergleichen. Tatsächlich erwies sich der Kehlfleck als Drüsenkomplex mit Sekretsammelbecken und Ausleitgängen, der zehnmal dicker ist als die umliegende Schallblasenhaut.
Durch biochemische Untersuchungen der Kehldrüsen von vier Arten, die während der Regenzeit in Uganda gemeinsam rufen, konnten wir insgesamt 56 Duftstoffe identifizieren – manche davon sogar noch völlig unbekannt. Und jede untersuchte Art scheint einen einzigartigen Duftcocktail zu produzieren.
Warum aber sind akustische Signale für Riedfroschweibchen nicht ausreichend, um zur Fortpflanzungszeit den Weg zu einem geeigneten Partner zu finden? Ein möglicher Grund für dieses Phänomen fällt auch dem menschlichen Beobachter auf: Obwohl Männchen mehrerer nahverwandter Arten gleichzeitig im selben Sumpf rufen und sie sich augenscheinlich nicht örtlich einnischen, klingen ihre Rufe zum verwechseln ähnlich – eine Situation, die für Froschforscher sehr ungewohnt ist. Normalerweise sind die sogenannten Anzeigerufe der Männchen wie eine akustische Visitenkarte, aber bei Riedfröschen ist die Zuordnung nicht so einfach.
Um ein attraktives arteigenes Männchen im Schilfdickicht zu finden, dürften also drei Signale nötig sein. Der Ruf lockt Weibchen vermutlich aus der Ferne an, der Farbfleck auf der mit Luft gefüllten Kehle dürfte bei der Nahortung helfen und gleichzeitig eine Drüse sein, deren Duftsekret Auskunft über die Artzugehörigkeit gibt.
Wie genau die Signale zusammenspielen und welche Signalkombination auf Weibchen besonders attraktiv wirken werden wir in den nächsten Jahren näher untersuchen. Dazu haben wir im März 2013 Frösche aus Ruanda nach Wien gebracht, um sie das ganze Jahr über beobachten zu können und ihre komplexen Signale mit Hilfe von Verhaltensversuchen zu entschlüsseln.
Weiterführende Links
Link zur frei zugänglichen Originalpublikation mit weiteren Abbildungen: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bij.12167/abstract
Informationen zur Familie Hyperoliidae, sowie Artenportraits mit Fotos: http://www.amphibiaweb.org/lists/Hyperoliidae.shtml





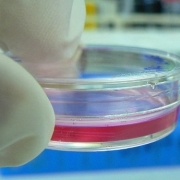
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns Deinen Kommentar!